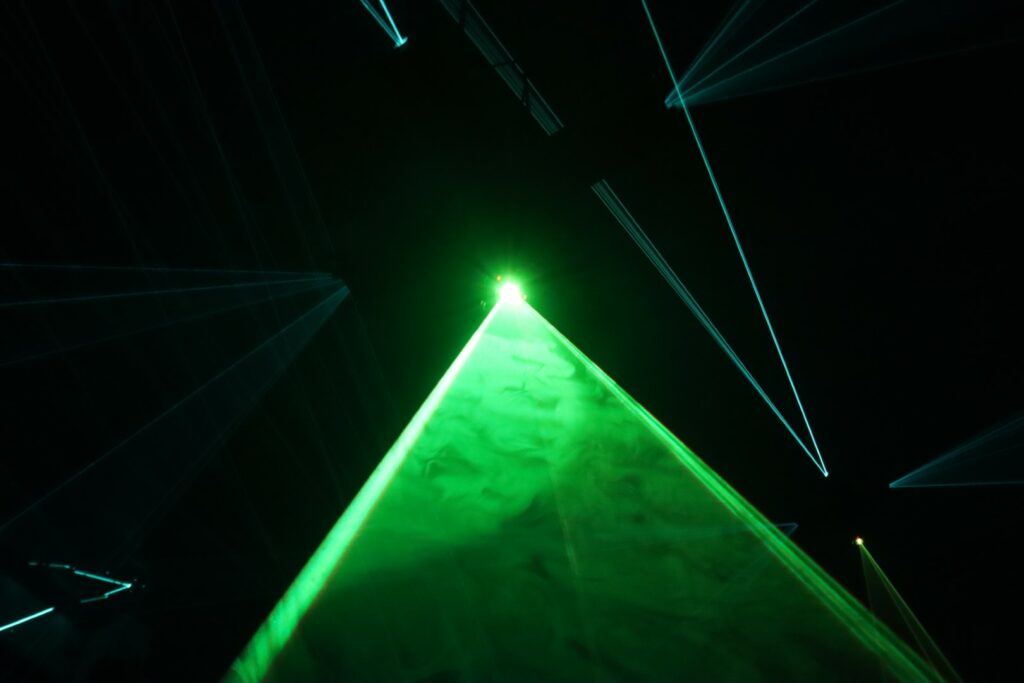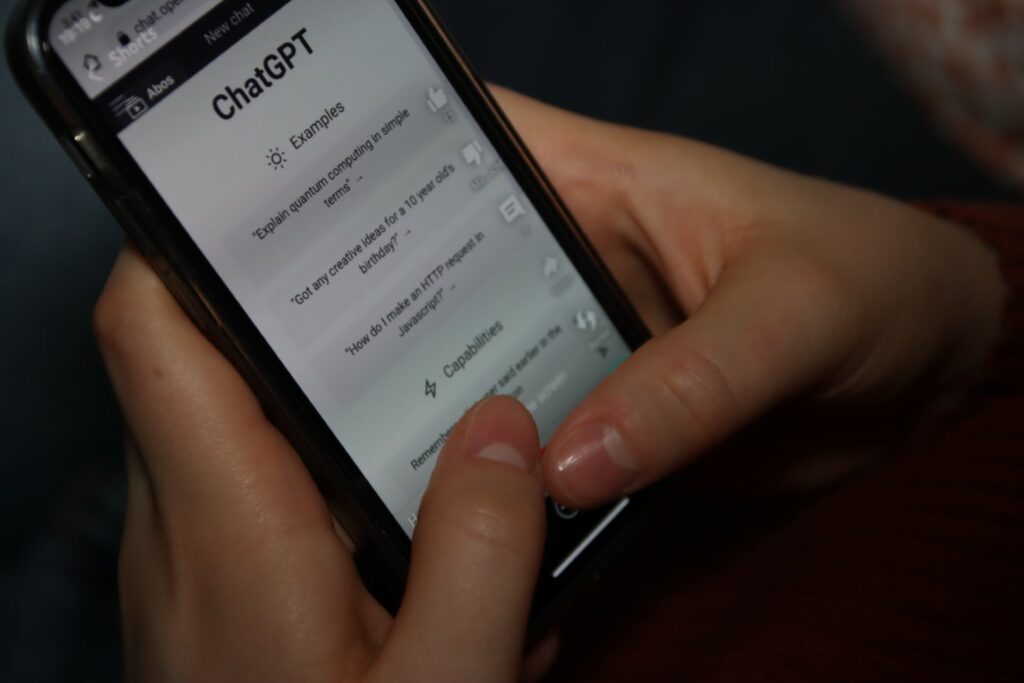erschienen im GREEN Magazine 2021
Wen kümmert schon dieses merkwürdige Grünzeug. Eine latscht gelegentlich darauf herum, ein anderer rupft es gedankenverloren vom Gemäuer. Beim Waldspaziergang wundern wir uns, wie es stoisch Baumstämme und Steine überwuchert. Moos ist ein geheimnisvolles Gewächs. Und lästig für Gartenfreunde des englischen Rasens, die ihm mit schwerem Gerät den Kampf ansagen, wegen ihm Grasnarben aufreißen und es mühsam aus den Fugen ihrer Steinplatten popeln.
Dabei sollten wir den Moosen, die zu jeder Jahreszeit unsere Landschaften mit einem weichen, grünen Teppich überziehen, ruhig ein bisschen mehr Respekt erweisen. Denn sie sind nicht weniger als der Ursprung allen Lebens jenseits der Meere. Und mehr denn je werden sie nun unser Leben entscheidend verbessern.
Einst war die Erde wüst und leer. Bis vor gut und gern 450 Millionen Jahren eine Alge auf die Idee kam, ihren Feinden zu entwischen und aufs Land zu ziehen. Die Urkontinente Gondwana und Laurasia waren nichts als gigantische tote Felsen, die aus dem Ozean ragten. An ihren Ufern lernte die Alge, sich am Gestein festzuhalten und jenseits des Wassers zu überleben.
Auf dem kargen Untergrund musste sich die Pflanze ihre Nährstoffe aus der Luft holen. Dazu vergrößerte sie ihre Oberfläche durch feine Verästelungen. Stickstoff, Phosphor und Kalium ließen sich verstoffwechseln, indem sie durch kleine Kanäle in die Pflanze gelangten, ebenso wie schwer verdauliche Schwermetalle.
Du Runzelbruder!
Das Gewächs wuchs und wuchs zu Tausenden von Moosarten heran und verteilte sich mit seinen Sporen über die Kontinente. Das Silbermoos, das Kranzmoos, das Purpurstielige Hornzahnmoos. Das Schnabeldeckelmoos, das Dachdrehzahnmoos, das kleine Blasenmützenmoos. Das Steifblättrige Frauenhaar, das Dickhaarige Spalthütchen, der Sparrige Runzelbruder.
Und noch grob 16.000 andere, auf denen nach und nach mehr Pflanzen gedeihen konnten. Farne, Büsche, Bäume. Ein Lebensraum für Gekrabbel und Geziefer, für Kleinstinsekten, die von größeren Tieren gefressen wurden, die sich ebenfalls entschieden hatten, an Land zu gehen. Aber das war zu dem Zeitpunkt schon durch und durch vom Moos besiedelt…
Allmählich lernen wir mehr über das unterschätzte Grün. Inzwischen wissen wir, dass Moose auf genetischer Ebene komplexer sind als Menschen. Forscher an der Universität Freiburg haben ein Laubmoos analysiert, das über 10.000 Gene mehr verfügt als das menschliche Genom. Trotz eines einfachen Bauplans, ohne Wurzeln, Blüten und Samen. Der offenbar noch einfacher gestrickte Mensch hat das Moos zunächst dafür genutzt, um seine Kissen und Decken damit auszustopfen. Auf plüschigen Sorten wie dem Schlafmoos und dem Polsterkissenmoos lag es sich bequem.
Heute liegt der große Nutzen des Mooses eher in seiner Anspruchslosigkeit und seiner offenporigen Oberfläche. Die ist nicht von der typischen, wächsernen Schicht umgeben, mit der andere Pflanzen ihre Blätter schützen. Dafür ist sie elektrostatisch geladen und hält ebenfalls geladene Schadstoffe fest, ganz nebenbei. Auch die aus unseren Kraftwerken, Öfen und Automotoren. Auch die, die beim Abrieb von Bremsen und Reifen in unsere Atemluft gelangen. Der Feinstaub, der unsere Arterien und Organe bis hinein ins Hirn verseucht und uns fortschreitend krank macht. Stickstoffdioxid, das Reizgas, das so tief in unsere Atemwege gelangt, dass sich die Lungenbläschen entzünden. Der ganze Dreck, an dem wir zurzeit ersticken.
Moos kann Dreck
Moos kann mit dem Dreck etwas anfangen. Es ernährt sich davon. Etwa die Hälfte des Feinstaubs besteht aus Ammoniumsalzen, die aus Ammoniak und Stickoxiden bestehen. Das Moos nutzt diese Salze als Treibstoff. Anderer Staub wie etwa Kohlenstoffverbindungen aus dem Reifenabrieb wird wohl von Bakterien abgebaut, die auf dem Moos leben. Laborversuche haben gezeigt, dass Moos über die Hälfte des gebundenen Feinstaubs in knapp einem Monat abbaut. An die 20 Gramm Feinstaub würde ein Quadratmeter insgesamt Moos aufnehmen können.
Also wächst Moos überall, nicht nur im Wald, auch in der Stadt, vertikal die Mauern und Dächer hinauf. Fehlt dem Moos Wasser, trocknet es kurzzeitig aus und blüht zu günstigeren Zeiten wieder auf. Und während es gedeiht, reinigt das Moos die Luft, kühlt sie, speichert CO2. Diese guten Eigenschaften kann man nutzen. Denn während auch mit höheren Spritpreisen, Umweltzonen und Fahrverbote weiterhin dicke Luft herrscht, sind es die grünen Moosfilter, die für ein besseres Klima sorgen.
In der Halle riecht es ein bisschen nach Wald. Zwar sind weit und breit keine Bäume zu sehen, auch kein plätschernder Flusslauf. Dafür aber mit Moos bewachsene Matten, die in unzähligen Reihen wie in einer überdimensionalen Kleidergarderobe an Haken hängen und von einem sanften Sprühnebel benieselt werden. In einem satten Grün durchdringen die zarten Blätter die Textilstruktur. Sie fühlen sich ganz flauschig an, als würde durch das Fell eines Tieres streichen. Nur halt irgendwie grüner.
Hier, in der Gemeinde Bestensee im Süden des Berliner Speckgürtels, zwischen Brandenburgischer Seenlandschaft, alten Panzerstraßen und ehemaligen DDR-Flachbauten der Nationalen Volksarmee forscht Peter Sänger auf seiner Farm an der Wirksamkeit von Moosen. Der studierte Gartenbauer hat mit seinem Freund Liang Wu eine Firma gegründet, die Moosfilter entwickelt und überall dort aufstellen will, wo Feinstaub Mensch trifft.
Green City Solutions
„Wir arbeiten hier mit einem nachhaltigen, vielleicht dem nachhaltigsten Filter überhaupt“, erklärt Sänger. Der 30-Jährige steht vor der ersten Reihe der Mattengarderobe und zupft ein paar weiße Pappelpollen von seinem Moos. „Wir haben ihn nicht erfunden. Die Natur hat das für uns getan. Jetzt müssen wir nur wissen, wie wir ihn richtig einsetzen.“ In seinem markanten vogtländischen Dialekt schwärmt Peter Sänger von der Pflanze seines Vertrauens. Moos sei ein beständiger Organismus, der mit Stress umgehen könne. Mit Trockenheit, mit Luftzug, mit reichlich Schadstoffen. „Das sind alles Bedingungen, die eine Kulturpflanze nicht so nett finden würde.“
Wie Nutzpflanzen für gewöhnlich zu behandeln sind, weiß Peter Sänger genau. Er und sein Bruder sind in einer Gärtnerei aufgewachsen, ein Generationenbetrieb mit der Liebe zu Pflanzen. Bis heute hilft dort sein Großvater mit. Er habe ein besonderes Gespür für alle Gewächse, erzählt der Enkel. „Doch mit Liebe und Gefühl Pflanzen verkaufen, das war mir zu heikel“, sagt Sänger. „Heute muss man die Kunden mit messbaren Daten überzeugen.“ Also eignete sich Peter Sänger mehr Fachwissen an. Er ist der Erste in seiner Familie, der Gartenbau an der Uni studierte.
Auf dem Dresdener Campus lief der Unternehmer auch Liang Wu über den Weg. Sie besuchten zusammen Seminare zu Vertical Farming und tauschten sich darüber aus, wie man mit cleverer Biologie die Luftverschmutzung bekämpfen und die Welt retten könne. Das war 2013, Sänger 23 Jahre alt, als Nachhaltigkeit und die gesamte Verantwortung für das Klima noch als nischiges Randthema veganer Ökohippies abgekanzelt wurde.
Die beiden stellten also einen Businessplan auf. Wälzten Wirtschaftsbücher, parallel zur Literatur über Botanik und Landschaftsgestaltung; Markt checken, Konkurrenz und Angebot, Herausforderungen und Möglichkeiten überschauen. Teure Moosproben aus dem Ausland bestellen, Geld versenken, herumprobieren, scheitern, für Stipendien bewerben, Startup gründen. Die Idee vom Moos als Biofilter elektrisierte die beiden Männer.
„Unsere erste Idee war ein QR-Code auf Pflanzenbasis“, erinnert sich Sänger. „Wir wollten Moose in verschiedenen Grüntönen an einer Wand wachsen lassen.“ Die sollte man dann mit dem Smartphone scannen und auf irgendeiner Website rauskommen, während der grüne Code seinen Feinstaubfiltergeschäften nachgeht.
„Wir mussten auf den Markt, obwohl wir noch überhaupt kein funktionierendes Produkt hatten“, erinnert sich Peter Sänger. „Das ist die hässliche goldene Regel der Startups: Du musst raus an die Kunden, sofort.“ Will dann einer dein Produkt kaufen, hast du ein Problem, weil du nicht fertig bist. Will keiner dein Produkt kaufen, hast du ein größeres Problem, weil du kein Geld kriegst.
Läuft nicht
Also fingen Sänger und Wu an, Mooswände zu bauen, alles DIY. Technik entwickeln, Metallgitter schneiden, schrauben und schweißen. Kleine Töpfchen für das Moos in die Vorrichtungen klicken. „Eintausendsechshundertzweiundneunzig Stück pro Wand“, betet Sänger herunter. „Die Zahl vergisst man nicht mehr, wenn man alles in Handarbeit macht.“ Die ganze Wand am Ende so hinbiegen, dass die Kanten halbwegs gerade aussehen und die ganze Sache irgendwie professionell wirkt. „Natürlich auch sonntags, natürlich auch nachts.“ Sänger hat vergessen, wie viele Paletten Energydrinks sich die beiden reingepfiffen haben.
Sänger und Wu ließen sich vom Markt treiben und versuchten dabei nicht die Nerven zu verlieren. Das erste selbst verdiente Geld kam von einem Versicherer in Jena, dann folgte die Einladung auf die Hannovermesse. Also Visitenkarten drucken und einen topseriösen Eindruck machen. Nachts im Blaumann an der Mooswand verzweifeln, morgens Sakko überziehen und Messestand betreiben, nach Feierabend zurück in den Blaumann und weiterbauen.
Doch so richtig rund laufen wollte die Idee mit der Mooswand nicht. Die Idee mit dem QR-Code hatten die jungen Unternehmer sowieso schon verworfen. Das Moor wucherte und verfärbte sich zu schnell, um leserlich zu bleiben. Auch die Wand als solche war viel zu mühsam aufzubauen und zu sperrig zu befördern. Das größte Problem war aber das Moos selbst. „Wenn die Moose nicht ausreichend befeuchtet werden, können die noch so robust sein“, erklärt Sänger. Die grünen Filter trockneten aus, mehr früher als später – und das Moos fiel von der Wand.
Die Erfahrung machten auch Forschende in Stuttgart. Sie hatten medienwirksam ein paar Moosmatten an eine Lärmschutzwand genagelt und den Effekt des natürlichen Feinstaubfilters messen wollen. „Erst haben wir uns gefreut, dass das ganze Thema nun Aufschwung kriegt, Wettbewerb belebt ja das Geschäft und so weiter.“ Doch das Stuttgarter Moos ging jämmerlich ein. Die Wand war für das Moos zu nah an der Straße platziert. Der Fahrtwind der Autos und Lkw wirkte wie ein Föhn, pustete den Wassernebel fort und trocknete die Moose aus. Auch wenn die Forschenden überzeugt davon waren, dass das Moos die Luft erfolgreich filtert, war für die Kunden nach dem Experiment klar: Die Sache mit dem Biofilter ist für die Tonne.
„Es ließ sich nur schwierig nachweisen, wie viel Feinstaub und Stickstoffoxid die Moose aus der Luft filtern“, sagt Peter Sänger. „Was nicht heißt, dass der Effekt nicht da war.“ Sänger und Wu wollten ihr Projekt nicht aufgeben. Sie mussten die Technik verbessern und mit eindeutigen Daten zu überzeugen. Für die wissenschaftlich belegbaren Zahlen kam das Leibniz-Institut für Troposphärenforschung in Leipzig und das Institut für Luft- und Kältetechnik an Bord. Und was an der Technik verbessert werden musste, lag auf der Hand. Ohne eine aktive Bewässerung wäre die gesamte gute Idee zum Scheitern verurteilt.
Also entwickelten Peter Sänger und Liang Wu ein grün bemoostes Hightech-Monster. Sie ließen Biologie mit Technologie verschmelzen – und fütterten im Hintergrund eine künstliche Intelligenz mit Algorithmen. Ihre Moose würden fortan ununterbrochen durch Sensoren auf ihren Zustand gecheckt und je nach Wert bewässert und belüftet werden. So verwandelte sich die Mooswand in einen etwa drei Meter hohen, viereckigen Moosturm, hinter dessen Holzlamellen und Moosmatten sich ein System aus Bewässerung, Belüftung und aktiver Computersteuerung versteckt. Der City Tree war geboren.

Wir hängen auf der Sitzfläche des Moosturms ab. Es ist merklich kühler hier, das durchfeuchtete Grün und der Luftzug erweisen ihren Dienst. Die Zahlen aus Leipzig und Dresden belegen das. Aus der direkt angesaugten Luft nimmt das Moos um die 80% der Staubpartikel auf. In einem Umkreis von einem Meter kühlt der City Tree die Luft um vier Grad herunter und filtert über die Hälfte des Feinstaubs heraus. Bei anderthalb Metern ist es immer noch ein Drittel. Auch aus fünf Metern lässt sich die frischere Luft noch messen.
Unter uns ist ein großer Wassertank, hinter uns der Turm, in seiner Mitte die Technik mit Ventilatoren, Sprinkler, Sensoren und einem Computer, der von überall angesteuert werden kann. Oben das Moos: acht Matten in der Größe eines halben Quadratmeters. „Die filtern drei bis sechs Monate die Luft. Danach tauschen wir sie aus und päppeln die alten Moose wieder auf.“
Peter Sänger zeigt auf eines der altes Gewächshäuser, die das Unternehmen beim Umzug nach Bestensee günstig übernehmen und für sich nutzen konnte. Die so genannte Schattenhalle ist eine Art Rehabilitationszentrum für überarbeitete Moose. Die Kur: Pflanzenhormone, die richtige Düngestrategie, Brandenburger Landluft.
In den anderen Gebäuden der Moosfarm testen 30 Mitarbeiter neue Moossorten, sie optimieren die Beleuchtung und die Bewässerung, sie forschen an den Textilien der Matten, an Verdunstungspappen, sie bauen ihre Mess- und Ventilationstechnik um. Gleich um die Ecke hat die Firma einen Deal mit Naturschutz und Forst ausgehandelt. Auf einem abgesteckten Waldstück retten sie einheimische Flechten. Indem sie dort invasive Moose entnehmen, die die Flechten verdrängen. Eine Win-Win-Situation. Der Wald erholt sich und Peter Sänger kann günstig Moose züchten.
Inzwischen stehen City Trees in Berlin, Dresden, Hamburg. Einige in London, einige in Irland und auch in der Schweiz. Sängers Vision: City Trees überall dort, wo Menschen Feinstaub und Hitze ausgeliefert sind. An Haltestellen, Wartebereichen, Kreuzungen, auf Plätzen, in Kaufhäusern und Flughäfen. Das Thema, das Klima in den Städten aktiv zu verbessern, ist in der Gesellschaft angekommen und hört bei den City Trees noch lange nicht auf. Begrünte Fassaden und Dächer kühlen Gebäude und speichern das Wasser, das versiegelte Böden nicht aufnehmen können. Dort, wo Moos und anderes Grün gedeiht, entsteht ein kühleres, feuchteres Klima. „Die Städte müssen nicht nur als Ursache des Klimaproblems hinhalten“, sagt Peter Sänger. „Sie können auch Teil seiner Lösung sein.“
Text und Bilder: Philipp Brandstädter