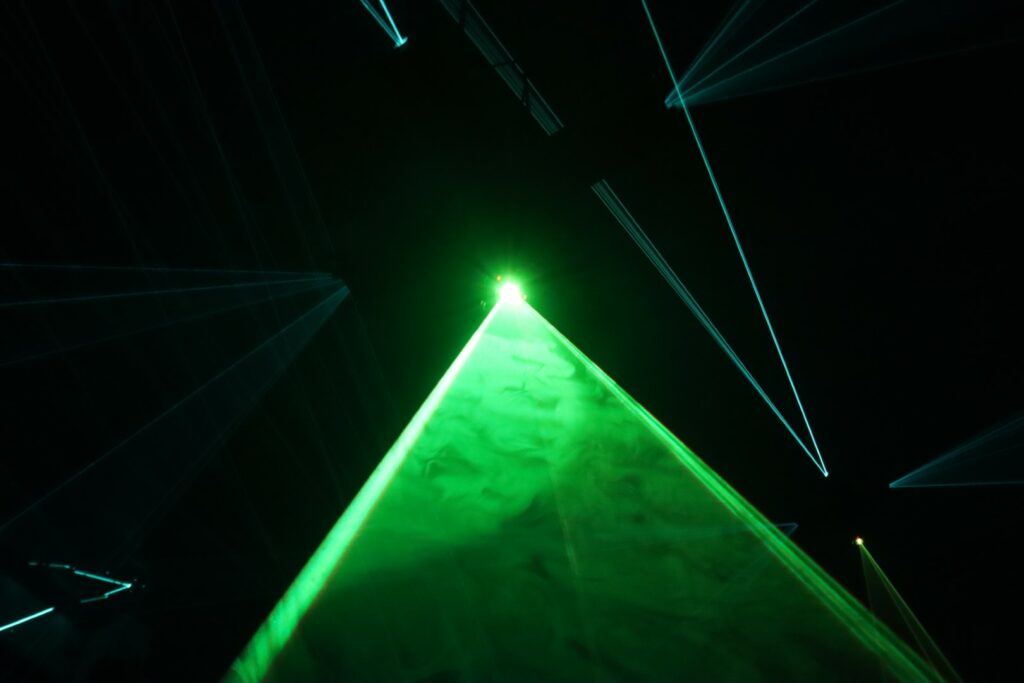erschienen in der GEO Special 06/2018
Tag 1: Halbinsel Nicoya
Was um Himmels Willen hat sich die Evolution dabei gedacht? Gemeinsam mit Rangerin Yama sitze ich am Strand des Schutzgebiets Ostional auf einem Baumstumpf und staune. Hunderte, Tausende Bastardschildkröten sind hier an der Pazifikküste der Halbinsel Nicoya gelandet, um sich mit ihren schweren Panzern über den Sand zu schieben. Graben sich mit ihren Flossen in die Tiefe. Legen ihre Eier ab und verscharren ihr Nest. Genau dort, wo sie selbst vor Jahren oder Jahrzehnten das Licht der Welt erblickt hatten. Dann schleppen sich die Schildkröten zurück ins Meer.
In manchen magischen Nächten, sagt Yama, kommen 10 000 Reptilien an Land. Yama hütet mit ihren Kollegen den Strand, zählt die erwachsenen Tiere, bewacht ihre Eier vor tierischen und menschlichen Dieben und hilft den Jungen später auf den ersten Metern ihres Lebens Richtung Pazifik. Die Schildkrötenmütter direkt neben mir sind wie in Trance, kümmern sich weder um mich noch um die gefräßigen Rabengeier, die darauf warten, ein Nest zu plündern. Am liebsten würde ich sitzen bleiben, bis die letzte Schildkröte ihren Weg zurück ins Meer gefunden hat. Und dann würde ich gern noch einmal 45 Tage bleiben, bis ihre Babys schlüpfen.
Yama sagt, die Sonne werde nun die Eier ausbrüten, ein paar Grad mehr oder weniger entscheiden, ob vorwiegend Männchen oder Weibchen schlüpfen. Nur ein Bruchteil von ihnen wird die nächsten Monate und Jahre überleben. Ich rieche das Salz des Meeres, lausche den schäumenden Wellen – und dem Ächzen und Schnaufen der Schildkröten. Dann stürzt die Sonne ins Meer, die Krötenpanzer schillern für einen Augenblick in Rot und Gold. Urplötzlich wird es zappenduster. Ich muss mich in Acht nehmen, auf meinem Weg zurück nicht über die Tiere zu stolpern.
Tag 2: Halbinsel Nicoya – Monteverde
Mühsam kämpft sich der jeep am nächsten Vormittag über eine asphaltierte Buckelpiste den Nebelwald nach Monteverde hinauf. Ein Gedanke tröstet mich: je katastrophaler die Straße, desto ursprünglicher die Gegend. Schlanke Teakbäume scheinen bis in die tief hängenden Wolken hineinzuragen. Ein Band von Mangoplantagen verbindet die Dörfer, wo Kinder in Schuluniformen auf dem Pausenhof toben. Zebus grasen, Brüllaffen hangeln sich an Stromleitungen entlang, Aras durchstreifen die Baumkronen.
Am Nachmittag lädt mich mein Fahrer Luis nach vier Stunden Rüttelfahrt vor einer riesigen Finca ab. Am Eingangstor wartet schon Adolfo Bello, der Besitzer. Sein Urgroßvater sei zum Goldschürfen hierhergekommen, erzählt der kleine, hagere Mann mit den geheimnisvollen dunklen Augen. Doch den wahren Schatz entdeckten die Bellos in der Kaffeepflanze. Die rote Arabica-Bohne gewinnt auf dem vulkanischen Boden und in dieser Höhenlage ihr intensives Aroma. Darum betreibt die Familie hier auf ein paar Hundert Hektar ökologischen Kaffeeanbau. Keinerlei Chemikalien kämen zum Einsatz, beteuert Adolfo
Über vier Generationen haben die Farmer gelernt, mit welchen Pflanzen sie ihre Sträucher vor schädlichen Insekten, Pilzen und Unkraut schützen. Adolfo zeigt uns eine Kurkumapflanze, deren Duft Ungeziefer abhält. Sein Bruder, erzählt er weiter, versprühe außerdem einen Extrakt aus der berauschenden Engelstrompete als Schädlingsschutz. Wie das genau funktioniert? Adolfo weicht aus. Er kümmere sich vor allem um das Rösten der Bohnen, sagt er und schmunzelt. Die wahren Geheimnisse des Bello-Kaffees bleiben in der Familie.
Der Duft gerösteter Kaffeebohnen lockt uns zu dem niedrigen Holzhaus inmitten der blühenden Felder. Ich schlendere an Kaffee- und Kakaopflanzen, Bananenstauden und Avocadobäumen vorbei und steige die Stufen zu der Veranda hinauf, wo Adolfos Frau Isabella auf offenem Feuer Kochbananen frittiert und Kaffee brüht. Isabella serviert die Bananen mit Sauerrahm und schenkt mir von ihrem schokoladig-nussigen Biokaffee ein. Und der ist die Wucht in Tassen.
Tag 3: Monteverde – La Fortuna
Gut 100 Kilometer und vier Atunden Autofahrt entfernt von der Kaffeefarm der Bellos, inmitten tropischer Wildnis, liegt das Städtchen La Fortuna. Hier sind die Straßen besser, gesäumt von Hotels, Restaurants und Geschäften. Der Grund dafür qualmt am Horizont: der Arenal, touristischer Anziehungspunkt und einer von 100 Vulkanen, die gemeinsam die mittelamerikanische Landbrücke bilden. Die meisten von ihnen schlafen seit Jahrtausenden. Nicht so der Arenal. Der hat zwischen 1968 und 2010 häufig gewütet und gespuckt, hat schwarze Asche und rot glühende Felsbrocken in die Luft geschleudert, sogar seine kegelige Vulkanspitze abgesprengt.
Gerade schlummert der 7000 Jahre junge Vulkan, nur etwas Rauch steigt aus seinem Krater. Im Arenal-Nationalpark an der Südseite, keine halbe Stunde von La Fortuna entfernt, steige ich den breit gepflasterten Pfad bis zum Arenalsee hinunter. In den Kronen der Würgefeigen, Mahagonigewächse und Kapokbäume sitzen gut getarnte Arassaris, kleine Tukane, feuerrote Tangaren, Sperlingsvögel, und riesige Tukane. Kolibris trinken Nektar aus Helikonienblüten, umtänzelt von kristallinen Glasflügelfaltern, anmutig schwebt ein Blauer Morphofalter vorbei. Echsen verharren im Geäst, eine Gruppe junger Nasenbären versteckt sich im Dickicht. Auf dem Pfad durch den Park spaziert es sich wie durch einen Zoo. Ich muss mir immer wieder in Erinnerung rufen, dass das hier unmittelbare Wildnis ist.
Anderthalb Stunden vom Arenal entfernt, in der Nähe von San Rafael de Guatuso, besuche ich die Maleku. Nur noch gut 600 Mitglieder der indigenen Minderheit leben hier in einem Reservat, wo sie ihre eigene Sprache und Riten bewahren. Diesig und schwitzig warm ist es in der scheunenartigen Gemeinschaftshütte des 3000 Jahre alten Stammes. Dort servieren mir Maleku in traditioneller Kleidung aus geschnürtem Bast fruchtig-süßen Maiswein. Ein Mann reicht mir eine Heilpflanze. Nichtsahnend kaue ich auf dem Blattstängel eines dornigen Strauches herum, dem cordoncillo. Erst spüre ich hundert feine Nadelstiche auf meiner Zunge. Und dann überhaupt nichts mehr. Mein Gesicht schläft ein, ich bin betäubt. Ich würde mir gern ein paar Pflanzen einpacken lassen. Für den nächsten Zahnarztbesuch. Oder so.
Tag 4: La Fortuna – Savegre-Tal
In einem Kleinflugzeug geht es in einer halben Stunde von La Fortuna zurück nach San José. Die Luftlinie erspart mir das stundenlange Stehen im Stau. Die Hauptstadt wurde einst als Kaffeeplantage angelegt, nicht als Millionenmetropole. Kilometerlange Blechlawinen durchziehen den Speckgürtel bis ins Zentrum. Ich steige am Flughafen in meinen gemieteten Jeep und schlage für die nächsten 180 Kilometer die berühmte Panamericana gen Süden ein.
Kurz hinter dem Örtchen San Isidro de El General geht es bergab: Zwei Stunden lang kriecht der Wagen auf schmalen Schotterpfaden das Savegre-Tal hinunter. Nebelwolken umhüllen die Eichenwälder, in denen Jaguare, Tapire und Pumas leben. Der eigentliche Star aber ist der Quetzal, den ich unbedingt mit meiner Kamera einfangen will – der mythenumrankte Göttervogel der Azteken und Maya. Rar und streng geschützt.
Jorge Serrano flüstert nur zur Begrüßung. Der Ornithologe will den seltenen Vogel auf keinen Fall verscheuchen. Schweigend folge ich Jorge über die steilen, glitschigen Pfade einer Farm. Der Besitzer habe den Göttervogel vor einigen Minuten auf einem seiner Avocadobäume gesehen und per Funk gemeldet, flüstert Jorge. Es ist kühl und nass, die Luft ist dünn, ich gerate außer Puste. Jorge hebt die Hand, ich versteinere und versuche, nicht zu keuchen. Suche durch meine Kamera das Geäst ab. Jorge baut sein Fernglas auf einem Stativ auf. Lauscht in die Bäume. Und pfeift, schrill wie ein Quetzal-Männchen.
ine Stunde vergeht, dann ist es so weit: Eine Henne mit schillernd grünem Federkleid, plüschigem Kopf und Knopfaugen landet in den Zweigen. Minuten später gesellt sich ein Männchen zu ihr, mit seinem knallroten Brustgefieder und langen Schwanzfedern. Andächtig stehe ich im Regen. Als die Fotos gemacht sind, packe ich die Kamera weg. Zeit, den Moment zu leben. Zu sein.
Tag 5: Savegre-Tal – Sierpe
Von den Bergen zurück an der Küste, zeigt sich mir das Land, wie ich es aus der Werbung kenne: türkisfarbener Pazifik, weiße Buchten. Grüne Hügel, von Wasserfällen zerschnitten. Neben den Straßen wechseln sich Bananen- mit Palmölplantagen ab, Hunde, Ochsen, Nasenbären dösen im Halbschatten der Bäume, Kinder kicken Bälle an bunt bemalte Hauswände, Händler verkaufen Gebäck und Kokosnüsse an den Kreuzungen.
Im »Soda Perla del Sur« im Dörfchen Sierpe serviert mir die Chefin des Hauses zum Mittagessen zitronige Ceviche als Vorspeise und das Nationalgericht Costa Ricas: Casados, Reis und schwarzen Bohnen. Dazu gibt es Käse und Fisch sowie verrückte Säfte aus gequollenen Chiasamen, Sternfrucht und Tamarinde – und natürlich herausragenden Kaffee. Früh habe ich gelernt: Das beste Essen gibt es in den schlichten sodas, kleinen, staatlich geförderten Restaurants in Familienbesitz, in denen gern mal Köstliches auf Kantinengeschirr serviert wird. Was folgt, ist eine Überdosis Artenvielfalt.
In Sierpe steige ich zu José Rodriguez auf sein motorisiertes Floß und tuckere mit ihm durch die Mangrovenwälder des Flusses Sierpe. José hat Adleraugen. Der Mann mit dem schmalen Schnauzbart zeigt mir Schleiereulen unter Brücken, bunt gefiederte Trogone und Tangaren, Faultiere, Wickelbären, Totenkopfäffchen. Er sei schon als Kind auf dem Sierpe unterwegs gewesen, erzählt der 53-Jährige. Er kenne nicht nur die besten Verstecke der Tiere, sondern spüre auch eine Art magische Verbindung zu ihnen. »Das ist eine Gabe«, erzählt Rodriguez, steuert das Boot unter ein großes Palmenblatt und deutet mit dem Finger hinauf: Eine schneeweiße Fledermaus hat das Blatt als Rastplatz gewählt. Ich schüttle ungläubig den Kopf und knipse, bis die Akkus nicht mehr können.
Tag 6: Sierpe – Nationalpark Manuel Antonio
Am nächsten Morgen fahre ich zurück an die Pazifikküste und erreiche anderthalb Stunden später mein letztes Etappenziel: Manuel Antonio. Südlich des Ortes Quepos erstreckt sich der berühmte Nationalpark, wo sich Urwald und palmenbewachsene, weiße Sandstrände auf eine einzigartige Symbiose eingelassen haben. Die Mittagshitze an der Küste ist erdrückend, der Meereswind spendet keine Abkühlung. Am Eingang vom Manuel Antonio werde ich von den Rangern penibel gefilzt, ob ich auch ja keine Snacks und Kippen dabei habe, die ich mehr oder minder freiwillig an die top organisierte Affen- und Waschbär-Mafia abtreten könnte.
Bei meiner Wanderung durch den Nationalpark folge ich einigen Guides und ihren Reisegruppen. Ohne sie hätte ich etliche gut getarnte Falter wie den Augenspinner oder die blattgrüne Saumfingerechse übersehen. Oder das knuffige Zweifingerfaultier, das mit seinem noch knuffigeren Zweifingerfaultierbaby in der Astgabel hängt. Und auch die Kapuzineraffen, wie sie sich lausen, wie sie spielen – und aufmerksam nach unbeaufsichtigten Handtaschen Ausschau halten. Amüsiert verfolge ich ein paar Waschbären auf Raubzug. Stets außerhalb des Blickfeldes ahnungsloser Besucher steuern sie auf deren Picknickkörbe zu, um sie eilig und mit geübten Pfotengriffen zu plündern.
Nach einem letzten Wandermarsch erreiche ich den versteckten Playa La Mancha. Ich verknote mein Hab und Gut sorgfältig an einem Ast und springe in die Lagune. Nirgendwo sonst habe ich so ruhiges, so badewannenwarmes Meereswasser erlebt. Minutenlang treibe ich auf den sanften Wellen. Tiefenentspannt. Soll die Tiermafia doch mit meinen Klamotten machen, was sie will. Pura Vida. Kurz darauf fällt Dunkelheit über Land und Meer. Ein Opossum latscht mir beim Zusammenpacken über den Fuß. Dann holen sich die Einsiedlerkrebse den Strand zurück. In der wolkenfreien Nacht gleißen die Sterne.
Text und Foto: Philipp Brandstädter